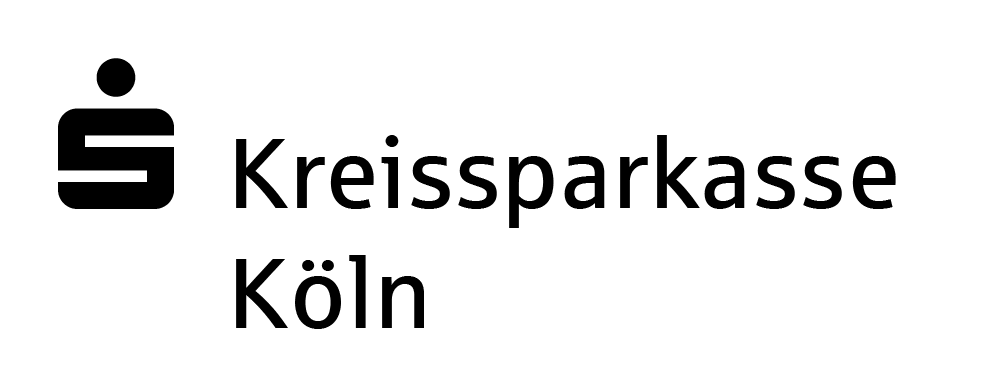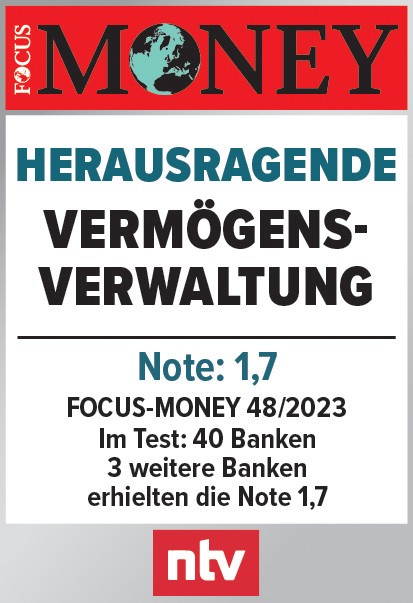Erzbistum Köln
Vom "Sancta Colonia" - Pfennig zum Kupferstüber
Seit Kaiser Otto I. (936-973) entwickelte sich Köln zur bedeutendsten Münzstätte Deutschlands und zu einem der größten Geldlieferanten Europas. Die "Sancta Colonia"-Pfennige wanderten von hier als silberner Strom nach Norden und Osten. Viele Mittelalterliche Schatzfunde in Skandinavien und Westrußland bestehen zum großen Teil aus Kölner Geprägen des 10. bis 12. Jh.
Damals gab es zunächst nur ein einziges Nominal, den silbernen Pfennig, auch Denar genannt. Später wurden als Kleingeld gelegentlich das Halbstück (Obol) und Viertelstück (Quadrans) geprägt.
Schon seit dem 10. Jh. machte sich der Einfluß der mächtigen Kölner Erzbischöfe auf die Münzprägung bemerkbar. Zunächst erschien der Name des Erzbischofs Bruno (953-965), der nicht nur Bruder des Kaisers Otto I., sondern auch Herzog von Lothringen war, neben dem des Kaisers auf den Pfennigen. Unter Erzbischof Pilgrim (1021-1036) entwickelte sich die kaiserliche Münzstätte allmählich zu einer bischöflichen; später erwähnte man die Namen der Kaiser einfach nicht mehr.
Im 14. Jh. verlangte die sich entwickelnde Wirtschaft durch ihren wachsenden Geldbedarf nach höherwertigen Münzen. Man prägte unterschiedliche Vielfache der Pfennige wie Groschen, Schillinge (12 Pfennige), Doppelschillinge, Turnosen und Weißpfennige. Der Rheinische Goldgulden entstand nach dem Vorbild des Fiorino d'oro von Florenz, der im Rheinland bereits als Handelsmünze eingeführt war und hier zirkulierte.
Nachdem die Kölner Bürger 1288 (Schlacht bei Worringen) die Erzbischöfe aus ihrer Stadt vertrieben hatten, übten diese ihr Münzrecht nur noch in Münzstätten in der Umgebung Kölns aus. Erzbischöfliche Münzen wurden in Riehl, Königsdorf, Deutz und Bonn geschlagen, aber sie galten auch in der Stadt Köln, die erst 1474 das Münzrecht erhielt und seitdem eigene Münzen prägte.
In der 2. Hälfte des 18. Jh. sank die Bedeutung der Erzbischöflichen Münzprägung. In Verbindung mit einem allgemeinen wirtschaftlichen Niedergang wurden nur noch Kleinmünzen aus Kupfer und geringhaltigem Silber geschlagen. Nach 1777 erlischt die Prägung völlig.

Soester Nachprägung eines Kölner Pfennigs der Kaiser Otto II. und III., 973-1002, geprägt im 11. bis 12. Jh.
SANCTA COLONIA / ODDO IMP AVG (entstellt).
Die Pfennige der reichen Handelsstadt wurden überall akzeptiert und auch nachgeahmt, man findet sie bis ins Baltikum.
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, die unbedingt erforderlich sind, um Ihnen unsere Website zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie Ihre Zustimmung erteilen, verwenden wir zusätzliche Cookies, um zum Zwecke der Statistik (z.B. Reichweitenmessung) und des Marketings (wie z.B. Anzeige personalisierter Inhalte) Informationen zu Ihrer Nutzung unserer Website zu verarbeiten. Hierzu erhalten wir teilweise von Google weitere Daten. Weiterhin ordnen wir Besucher über Cookies bestimmten Zielgruppen zu und übermitteln diese für Werbekampagnen an Google. Detaillierte Informationen zu diesen Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Ihre Zustimmung ist freiwillig und für die Nutzung der Website nicht notwendig. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“, können Sie im Einzelnen bestimmen, welche zusätzlichen Cookies wir auf der Grundlage Ihrer Zustimmung verwenden dürfen. Sie können auch allen zusätzlichen Cookies gleichzeitig zustimmen, indem Sie auf “Zustimmen“ klicken. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit über den Link „Cookie-Einstellungen anpassen“ unten auf jeder Seite widerrufen oder Ihre Cookie-Einstellungen dort ändern. Klicken Sie auf „Ablehnen“, werden keine zusätzlichen Cookies gesetzt.